Immer wieder taucht diese Frage in Mails auf und ich habe sie auch schon mehrfach beantwortet. Heute jedoch bin ich auf einen Artikel gestoßen, der das noch viel besser und ausführlicher erläutert. Ich bin dem Jüdischen historischen Verein Augsburg dankbar, daß er mir gestattet hat, den Text hier als Vollzitat wiederzugeben:
„Oft werden wir nach der Bedeutung und Herkunft der überall anzutreffenden Sitte gefragt, auf jüdischen Grabsteinen und Denkmälern Steinchen, meist Kieselsteine abzulegen. Allgemein wird dies auch von sog. Fachleuten mit einer für „Nomaden“- oder „Wüstenvölker“ angeblich typische Bestattungspraxis erklärt. Demnach legte man auf die Grabstätte Steinhaufen, um den Leichnam vor wilden aasfressenden Tieren zu schützen. Der Vorstellung nach haben Angehörige bei jedem Besuch ab und an weitere Steine dazugelegt, um diesen Schutz zu erneuern, woraus sich sodann der entsprechende Brauch entwickelt habe. Sollte es ein solches Brauchtum tatsächlich jemals gegeben haben, so hatten die (wann eigentlich?) „nomadisierenden“ Juden ihn wohl bereits vergessen, als sie in Israel sesshaft wurden, zumindest kennt auch der Talmud keine entsprechende Praxis. Sie wäre auch gänzlich unnötig, wenn man den Leichnam tief genug begräbt …
Tatsächlich geht die Praxis aber wohl doch auf die im antiken Israel übliche Bestattung zurück, die jedoch in vielen Einzelteilen von der heutigen abweicht. In aller Regel wurden Tote selten auf Äckern oder eigenen Grabfeldern bestattet, sondern in Grabhöhlen, die meist einzelnen Familien gehörten und oft auch wie im antiken Ägypten eigens für den Zweck der Bestattung künstlich geschaffen wurden und nicht selten über einen Zugang mehr oder minder tief unter die Erde, bzw. in den Felsen reichten.
Die Bestattung vollzog sich anders als heute in zwei Schritten. Zuerst wurde der Leichnam auf einer Art Steinbett zur raschen Verwesung aufgebahrt, später wurden die Knochenreste eingesammelt und gesammelt, um sie endgültig in einem kleinen, platzsparenden, meist in etwa quadratischen Steinbehälter, lat. Ossarium („Knochenhaus“) zu sammeln, welches sodann in einer Nische כוך (kùch) in einer Seitenwand der Familiengruft beigesetzt wurde. Sehr häufig wurden diese Behälter beschriftet mit dem Namen des Verstorbenen. Die Grabhöhle oder der Teilbereich einer Grabhöhle, etwa der der einer einzelnen Familie gehörte, wurde mit einem beweglichen, גולל (golèl) genannten Stein verschlossen, der seinem Namen nach meist rundlich war, aber auch in quadratischer Form belegt ist. Zur Festigung oder Sicherung dieses Golel-Steines nun benutzte man kleine Steine, den sogenannten דופק (dofèk), der nach jedem Besuch der Grabhöhle neu gelegt wurde, wörtlich etwa „der (An)Klopfer“ (vom Verb דפק dafak = (klopfen) und im heutigen Sprachgebrauch der (medizinische) Puls. Schon bei der Bestattung heißt es deshalb entsprechend דופק סתימת הגולל – der Dofèk verschließt den Golèl (Ket. 4b, Sanh. 47b, u.a.).
Als Dofèk nun durfte man nichts verwenden, was selbst gelebt hat, also nichts was von einem Tier oder einer Pflanze stammte, weshalb der Einfachheit halber der Brauch entstand, keilförmige oder andere kleine Steinchen als Abschluss zu nehmen. Im sprichwörtlichen Sinne führte dies auch zu Redensarten wie לא דופק לסוכה … ולא גולל לקבר – (wörtlich: kein golel für die Sucka zu groß] und kein golel fürs Grab zu klein]), sinngemäß etwa: weder das eine, noch das andere (nichts Halbes und nichts Ganzes, weder Fisch, noch Fleisch, etc.).
Der Brauch, einen Stein ans Grab zu legen stammt demnach aus der antiken Bestattungskultur der nahöstlichen Grabhöhlen, für deren Existenz uns schon die Thora das Beispiel der Machpela – Höhle bei Hebron gibt, die Abraham für seine Familie erwirbt. Sie ist keineswegs auf das Judentum beschränkt, so wie sich der Brauch kleine Steine auf das Grab zu legen auch in manchen katholischen Gebieten Italiens erhalten hat. Auch das Christentum überliefert z.B. im Evangelium Markus 16 den Golel.
Es ist zunächst die praktische Funktion des Dofèk, der als eine Art Riegel oder Sperre das unbeabsichtigte Wegrollen oder Verrutschen des meist runden Golèl verhindern soll, zugleich ist es aber im Wortsinn auch ein „Anklopfen“ (des Steinchens an den Grabstein) und deshalb ohne die frühere praktische Funktion als „Gruß“ an den Toten zu verstehen.“
Quelle: http://jhva.wordpress.com/2010/11/16/warum-legt-man-kleine-steine-auf-judische-grabsteine/
Mit freundlicher Genehmigung des „Jüdisch historischen Vereins in Augsburg“.
Hashtags:
Ich habe zur besseren Orientierung noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels zusammengestellt:
Keine Schlagwörter vorhanden


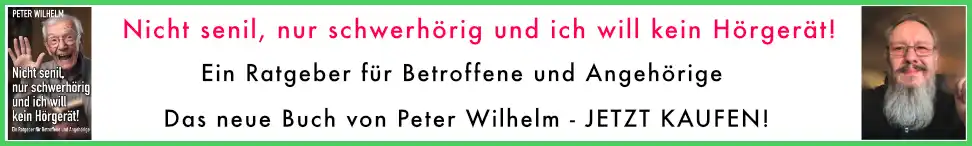








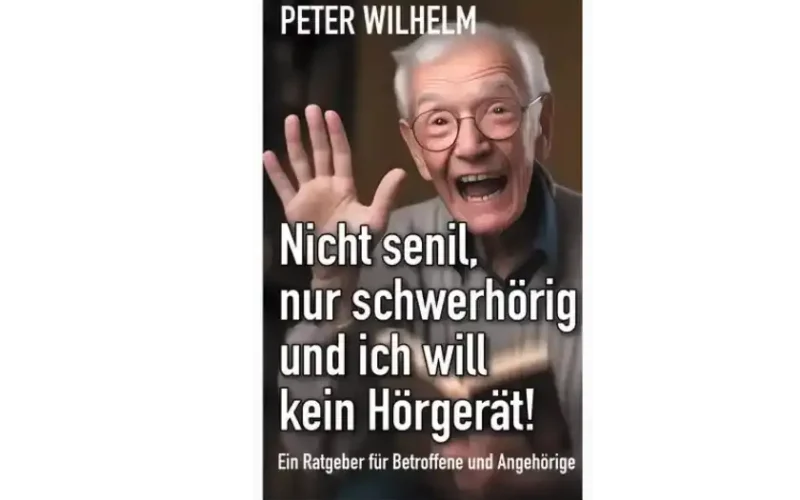


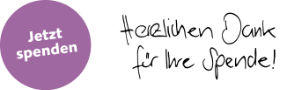





Nu, damit die Schwiegermutter drinnen bleibt.
Entschuldigung aber das ist ja jetzt mal voll geklaut. Hat der werte Herr Autor es also doch nötig woanders abzuschreiben.
Feiner Zug! Aber leider Pech gehabt, Du wurdest gleich entlarvt. Ich habe es bemerkt, setzen schämen!!!!!
@Botengänger:
Nicht bis ganz unten gelesen.
Setzen. Sechs.
Ein sehr interessanter Text, danke dafür. Das Steinchen als „anonymer Gruß“ an den Toten fand ich schon immer einen sehr netten Brauch, schön hier was über den Hintergrund zu erfahren.
Vorbildlich übrigens die Zitateinbindung, mit Verweis vor und nach dem Text, gerade bei längeren Zitaten finde ich das nett.
@Botengänger: erstmal lesen (steht sogar schon im ersten Abschnitt!!!), dann meckern!!!
Wow, mal wieder etwas schlauer geworden. Ich habe mich das nämlich immer wieder gefragt, vor allem wenn ich Schindlers Liste angeschaut habe und am Ende die Überlebenden auf sein Grab Steinchen legten. Auch hier in **** findet man ganz viele Steinchen auf den Gedenktafeln für die Synagoge, die bis 1939 da gestanden hat.
Tom hat seine Quellen doch genannt und offensichtlich auch gefragt, ob er das Zitat verwenden darf. Ich weiß also nicht, was die Aufregung soll.
Eine sehr schöne und ausführliche Erklärung, danke an Tom und den Verein.
Ich denke (hoffe), dass Botengänger lediglich den Ironie-Smiley vergessen hat.
@Botengänger: DU, setzen, sechs! Was im Internet steht kann man sowieso übernehmen. Ist alles frei und public domian.
Und wieder etwas gelernt, danke 🙂
Bisher hatte ich es gesehen wie den Brauch, beim Begräbnis eine Schaufel Sand auf den Sarg zu werfen, damit die ganze Gemeinschaft am Verschließen des Grabes beteiligt ist. Die Juden übertragen diese Pflicht meines Wissens den nächsten Verwandten, wir beteiligen uns nur. Vor dem Hintergrund, dass die Juden eine Grabstätte als ewig ansehen, leuchtet das auch ein: jede Generation erneuert die Verbundenheit mit der Gemeinschaft.
Man soll übrigens den Stein mit der linken Hand aufs Grab legen; nach jüdischer Vorstellung ist die mit dem Herzen verbunden.
@ „Babsi“.
„public domian“
Hihi.
Sehr interessant!
Bisher wusste ich von diesem Brauch nichts, aber der Mensch ist ja lernfähig 😉
Jemand, der sich Babsi nennt, schaufelte sich sein eigenes Grab und schrieb am 17.11.10 um 12:38 Uhr folgendes:
@Botengänger: DU, setzen, sechs! Was im Internet steht kann man sowieso übernehmen. Ist alles frei und public domian.
________
@babsi:
dann mach mal fleissig .. ich wünsche dir schon jetzt einen guten anwalt und viel kohle .. urheberrecht und so.. das internet ist auch für dich kein rechtsfreier raum 😀
@historician: also was manche leute so schreiben, natürlich ist im internet alles kostenlos und oft sogar komplett umsonst! schau doch mal nach, da gibts auch ironieschilder, gratis 🙂
@thema: eine ältere dame hat in einer gesprächsrunde mal empört gesagt dass die juden ja auch immer so steine mit ins grab kriegen, damit die damit nach dem herrn jesus werfen wenn sie ihn im jenseits sehen. hat der herr pfarrer den kindern damals so erklärt!
wie die sich allerdings jemals im jenseits hätten begegnen können und wie vor allem die steine mit dort hinüber gekommen wären, das hat hochwürden aber vermutlich nicht erklärt …
@ ingo (#13):
Als ehemaliges Sektenkind wäre ich an der Sache mit den Wurfgeschossen sehr interessiert, denn einige „Vorangegangene“ drohten mir zu ihren Lebzeiten an, mich einstmals „wiedersehen“ zu wollen. Legt mir Steine ins Grab, je mehr, desto besser! Ich verspreche auch (notfalls hoch und heilig), nicht auf den Herrn Jesus zu zielen.
@ Pu der Zucker.
Steinigung mal anders rum?
Beerdigung mit viel Schotter oder Kies (Hier, wundervolle Steine! Fühlen Sie die Qualität!) und aus dem Grab heraus wird zurückgeschmissen?
(Bevor jetzt die politisch korrekten Gutmenschen aufheulen: Ja ich bin just jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt furchtbar pöse pöse pöse und irgendwelche Debatten interessieren mich nicht.)
B. A.
@ BigAl (#15):
Ohje, neee, mit Steinigung hab ich doch nix im Sinn! Ich brauch die Steine fürs Jenseits, also nur so zur Sicherheit, zur Selbstverteidigung quasi, zur Abschreckung, – denn denen, die mich „einstmals wiedersehen“ wollten, möchte ich nie, nie, nie wieder, weder im Himmel noch in der Hölle, begegnen.
Oh, ich dachte, die Steine auf dem Grab sollen den Verstorbenen „erhöhen“.
13 ingo: Die Äußerung vom Herrn Pastor läßt einen mehr als nur latenten Antisemitismus durchblicken – das ist die Art unsinniges Gerücht, mit denen Minderheiten diffamiert werden, und steht hier in der unseligen Folge von Anschuldigungen, dass die Juden „Gottesmörder“ seien. Dass Kirchenmänner solch haarsträubendem Unsinn verbreiten (verbreitet haben?), enttäuscht mich, überrascht mich aber leider nicht wirklich.
@jemand: keine sorge, das muss sich vor über 100 jahren abgespielt haben, besagte gesprächsrunde hat vor etlichen jahren stattgefunden.
Als ich klein war, wurden mir die Steinchen bei Opa auf dem Grab (naja, Gedenkstein) abwechselnd als „damit die Toten drinnen bleiben“ und „wie Blumen, bloss nix lebendiges auf den Friedhof“ erklärt. So gaaanz abwegig war das ja dann doch nicht, wenn auch durch locker 45 Jahre Atheismus gewandert 🙂
Im Artikel steht unter anderem:
„so hatten die (wann eigentlich?) „nomadisierenden“ Juden“
Das „wann“ sollte der Verein im Alten Testament problemlos herausfinden können: http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/35070
(Den Kommentar habe ich auch im verlinkten Beitrag hinterlassen)