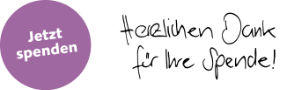Postmortale Eheschließung
Postmortale Eheschließung in Frankreich
Frankreich ist eines der ganz wenigen Länder der Welt, in denen eine Eheschließung auch nach dem Tod eines Partners rechtlich möglich ist. Die Grundlage dafür bildet Artikel 171 des Code civil, der diese außergewöhnliche Form der Trauung erlaubt – allerdings nur unter streng reglementierten Bedingungen.
Voraussetzung ist, dass ein „außergewöhnlich schwerwiegender Grund“ vorliegt. Das kann etwa der Fall sein, wenn das Paar bereits alle formalen Schritte zur Eheschließung unternommen hat, die Hochzeit jedoch durch den plötzlichen Tod eines Partners verhindert wurde. Ebenso kann die Geburt eines gemeinsamen Kindes, das vor der Trauung gezeugt wurde, ein solcher Grund sein.
Die Entscheidung liegt beim Staatspräsidenten, der die Eheschließung per Dekret genehmigen muss. Die Trauung erfolgt anschließend in Anwesenheit eines Standesbeamten und wird im Eheregister so eingetragen, als hätte sie zu Lebzeiten beider Partner stattgefunden – mit allen rechtlichen Konsequenzen, etwa in Bezug auf Erbrecht oder den Familiennamen.
Ein besonders bekanntes Beispiel ist der Fall eines jungen Paares, das kurz vor der Hochzeit stand. Der Bräutigam kam bei einem tragischen Unfall ums Leben, bevor die Trauung vollzogen werden konnte. In diesem Fall griff Präsident Charles de Gaulle persönlich ein und genehmigte die postmortale Ehe, die anschließend offiziell beurkundet wurde.
Auch Naturkatastrophen haben solche Eheschließungen ausgelöst: Nach dem Bruch des Malpasset-Staudamms in der Nähe von Fréjus am 2. Dezember 1959, bei dem 423 Menschen ums Leben kamen, nutzten mehrere Hinterbliebene die Möglichkeit, ihre bereits verstorbenen Partner posthum zu heiraten. Für die Betroffenen war dies nicht nur ein Akt der Liebe, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Sicherung gemeinsamer Rechte und Ansprüche.
Frankreich zeigt damit, dass das Recht in seltenen Fällen menschliche Tragödien anerkennt und versucht, zumindest im Nachhinein formale Hürden zu überwinden – auch wenn der Bund fürs Leben bereits vom Tod überschattet wurde.
Postmortale Ehe in China – Geisterhochzeiten
In China existiert eine jahrhundertealte Tradition, die in Teilen des Landes bis heute praktiziert wird: die sogenannte „Geisterhochzeit“ (Minghun). Dabei handelt es sich um eine Eheschließung zwischen zwei Verstorbenen – oder zwischen einem lebenden und einem verstorbenen Partner.
Der Ursprung dieser Sitte liegt im Ahnenglauben und in der Überzeugung, dass auch im Jenseits soziale Bindungen fortbestehen. Ein Mensch, der unverheiratet stirbt, gilt in manchen Regionen als unvollständig und könnte als ruheloser Geist die Lebenden heimsuchen. Durch eine symbolische Eheschließung soll dem Verstorbenen im Jenseits ein Partner zur Seite gestellt und damit Harmonie hergestellt werden.
Früher wurden dafür oft hölzerne Figuren oder Papierfiguren angefertigt, die den verstorbenen Bräutigam oder die Braut darstellen. Diese wurden dann bei einer rituellen Zeremonie „verheiratet“ und zusammen beigesetzt. In manchen Fällen wurde eine lebende Person posthum mit einem Verstorbenen verheiratet, um familiäre Bündnisse oder Erbfolgen zu sichern.
Allerdings hat diese Tradition auch eine dunkle Kehrseite. Vor allem in ländlichen Gebieten kam es zu Fällen, in denen Leichname gestohlen oder illegal gehandelt wurden, um Geisterhochzeiten zu arrangieren – ein makabrer Schwarzmarkt, der immer wieder durch die Behörden aufgedeckt wird. Die chinesische Regierung hat deshalb Gesetze erlassen, die den Handel mit menschlichen Überresten streng bestrafen.
Trotz moderner Gesetze und wachsender Skepsis in den Städten überlebt die Geisterhochzeit in abgelegenen Provinzen weiterhin – oft als Mischung aus Ahnenritual, Familientradition und spiritueller Pflicht.
Weitere weltweite Beispiele
Auch außerhalb Frankreichs und Chinas gibt es vereinzelte Traditionen und rechtliche Regelungen zur Eheschließung nach dem Tod eines Partners. In Südafrika etwa ist die sogenannte postume Ehe zwar nicht gesetzlich verankert, wird jedoch in seltenen Fällen von bestimmten indigenen Gemeinschaften als kulturelle Praxis akzeptiert – oft, um die familiäre Ehre zu wahren oder die Versorgung gemeinsamer Kinder abzusichern.
In Südkorea sind Fälle dokumentiert, in denen postmortale Eheschließungen durch religiöse oder familiäre Zeremonien vollzogen wurden. Sie dienen dort weniger juristischen Zwecken, sondern sind Ausdruck tiefer familiärer Verbundenheit und Respekts gegenüber dem Verstorbenen.
Auch in einigen Militärtraditionen gab und gibt es vergleichbare Vorgehensweisen: So konnten in bestimmten Armeen, vor allem während kriegerischer Auseinandersetzungen, Paare kurz nach dem Tod eines Soldaten offiziell als verheiratet gelten. Damit sollte der hinterbliebenen Partnerin ein Anspruch auf Witwenrente oder militärische Ehren zuteilwerden. Solche Regelungen waren jedoch stets von der Zustimmung höherer Stellen abhängig und sind heute meist abgeschafft oder stark eingeschränkt.
Diese Beispiele zeigen, dass postmortale Eheschließungen in sehr unterschiedlichen kulturellen, rechtlichen und historischen Kontexten vorkommen – mal als festgeschriebenes Gesetz, mal als tief verwurzelter Brauch oder als pragmatische Ausnahme im Zeichen besonderer Umstände.
Siegelung an einen verstorbenen Ehepartner bei den Mormonen
In der Glaubenspraxis der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) spielt die sogenannte Ehe-Siegelung (sealing) eine zentrale Rolle. Sie unterscheidet sich grundlegend von einer rein zivilen oder kirchlichen Eheschließung, wie sie in anderen Religionen bekannt ist. Nach mormonischem Verständnis kann eine Ehe im Tempel „für Zeit und Ewigkeit“ geschlossen werden – nicht nur bis zum Tod, sondern auch darüber hinaus.
Besonders bemerkenswert ist, dass diese Siegelung auch dann noch vorgenommen werden kann, wenn ein Ehepartner bereits verstorben ist. Grundlage dieser Praxis ist der Glaube, dass Familienbande im Jenseits fortbestehen und durch die Siegelung für die Ewigkeit Bestand haben. So können Witwen oder Witwer im Tempel an ihren verstorbenen Partner „gesiegelt“ werden, um im kommenden Leben wieder vereint zu sein.
Die Zeremonie findet in einem geweihten mormonischen Tempel statt und wird von Priestertumsinhabern durchgeführt. Ist ein Ehepartner verstorben, wird die Siegelung stellvertretend vollzogen – häufig mit einer lebenden Person als symbolischem Platzhalter. Diese stellvertretenden Handlungen sind im Mormonismus nicht ungewöhnlich und werden auch bei Taufen für Verstorbene praktiziert.
Wichtig ist, dass eine solche postmortale Siegelung nicht automatisch eine zivilrechtliche Ehe darstellt. Sie hat rein spirituelle Bedeutung und entfaltet ihre Wirkung ausschließlich im Glaubenskontext der Mormonen. Dennoch wird sie in der Gemeinschaft als ebenso verbindlich und bedeutsam betrachtet wie eine zu Lebzeiten geschlossene Siegelung.
In der mormonischen Kultur ist diese Praxis ein Ausdruck tiefen Familienglaubens und der Hoffnung auf ein Weiterleben gemeinsamer Bindungen nach dem Tod – und damit ein spirituelles Gegenstück zu den juristisch geprägten postmortalen Eheschließungen etwa in Frankreich.
Fazit
Postmortale Eheschließung ist – abgesehen von Frankreich – meist symbolischer Natur, nicht rechtsgültig. Frankreich ist eine bemerkenswerte Ausnahme, bei der der Staat unter engen Voraussetzungen eine solche Ehe anerkennen kann. In China diente die Praxis traditionell bestimmten sozialen Funktionen. In anderen Ländern bleibt sie entweder symbolisch oder rechtlich nicht zulässig.
Links
Weiterführende Links: Postmortale Ehe / Geisterhochzeit / Siegelung
- Überblick
- Frankreich (mariage posthume)
- China (Geisterhochzeit / 明婚, 冥婚)
- Mormonen (LDS): Siegelung & stellvertretende Siegelung
- Weitere Länder/Beispiele
Episodenliste:
- Bestattung interkulturell: Einleitung
- Bestattung interkulturell: Christentum
- Bestattung interkulturell: Kirche Jesu Christi - Mormonen
- Bestattung interkulturell: Judentum 1
- Bestattung interkulturell: Judentum 2
- Bestattung interkulturell: Islam 1
- Bestattung interkulturell: Islam 2
- Bestattung interkulturell: Buddhismus 1
- Bestattung interkulturell: Buddhismus 2
- Bestattung interkulturell: Hinduismus 1
- Bestattung interkulturell: Hinduismus 2
- Bestattung interkulturell: Freimaurer
- Bestattung interkulturell: unterschiedliche Nationen
- Bestattung interkulturell: Luftbestattung Vogelbestattung, Himmelsbestattung
- Bestattung interkulturell: Altkatholische Kirche
- Bestattung interkulturell: Zeugen Jehovas
- Bestattung interkulturell: Griechisch orthodox
- Bestattung interkulturell: Sinti und Roma
- Bestattung interkulturell: Anthroposophen, Christengemeinschaft
- Bestattung interkulturell: Scientology
- Bestattung interkulturell: Aleviten
- Bestattung interkulturell: Bahai
- Bestattung interkulturell: Winter in Kanada
- Bestattung interkulturell: Baptisten
- Bestattung interkulturell: Kopten
- Bestattung interkulturell: Mennoniten
- Bestattung interkulturell: Japan
- Bestattung interkulturell: Schweiz
- Bestattung interkulturell: USA
- Bestattung interkulturell: Kremation in den USA vs. Deutschland
- Bestattung interkulturell: Mexiko - Día de los Muertos
- Bestattung interkulturell: Madagaskar - Famadihana - Knochenwendung
- Bestattung interkulturell: Alte europäische Naturreligionen
- Bestattung interkulturell: Satanismus
- Bestattung interkulturell: Voodoo Ahnenkult und Mythen
- Bestattung interkulturell: Philippinen - Baum- und Hängesärge
- Bestattung interkulturell: Südkorea - Feuer und Perlen
- Bestattung interkulturell: Ghana - Phantasiesärge
- Bestattung interkulturell: USA Einbalsamierung
- Bestattung interkulturell: Spanien - überirdische Gräber
- Bestattung interkulturell: Bulgarien
- Bestattung interkulturell: Korea
- Bestattung interkulturell: Postmortale Eheschließung
- Bestattung interkulturell: Warum Juden die Tora begraben
- Bestattung interkulturell: Kannibalismus
- Bestattung interkulturell: Amish People – Schlichtheit bis zuletzt
- Bestattung interkulturell - Türkei - Das heilige Feuer der Schreibspäne
- Bestattung interkulturell - Die Niederlande
- Bestattung interkulturell - Haitianisches Voodoo – Wenn der Geist weiterlebt
- Bestattung interkulturell: Voodoo und Zombies
- Bestattung interkulturell: Feuerbestattung im Wandel