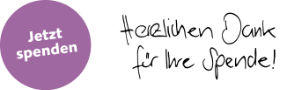Es gibt Bräuche rund um den Tod, die sind so still, so poetisch und zugleich so tief symbolisch, dass man sie kaum glauben mag. Einer davon stammt aus der Welt der türkischen Kalligrafen – jener Gelehrten, die ihr Leben dem Schreiben, dem Wort und der Schönheit der Buchstaben widmen. Sie behandeln ihre Schreibgeräte, Federn und selbst die beim Anspitzen entstehenden Holz- und Rohrspäne wie heilige Reliquien. Und wenn sie sterben, wird aus diesen unscheinbaren Resten ein Feuer entfacht, das eine letzte, zarte Verbindung zwischen dem Leben des Schreibers und seinem Abschied herstellt.
Der Kalligraf und seine Werkzeuge
Im islamischen Kulturkreis, besonders in der osmanisch-türkischen Tradition, genießt das Schreiben einen außerordentlichen Rang. Das erste Wort, das im Koran offenbart wurde, lautet „Iqra“ – „Lies!“ –, und die Feder, der Qalam, wird im Koran sogar ausdrücklich erwähnt: „Bei der Feder und bei dem, was sie schreiben“ (Sure al-Qalam, 68:1). Das geschriebene Wort gilt als göttlich inspiriert, das Werkzeug, mit dem es entsteht, als Träger einer besonderen geistigen Energie.
Kalligrafen betrachten ihre Federn, Tintenfässer und Messer daher nicht als bloße Arbeitsgeräte, sondern als Teil ihres spirituellen Lebens. Sie spitzen ihre Schilfrohre mit höchster Sorgfalt, und was dabei an kleinen Holz- oder Schilfspänen abfällt, wird nicht weggeworfen. Diese Reste bewahren sie über Jahre hinweg in kleinen Dosen, Schachteln oder Gläsern auf – sorgfältig, fast andächtig.
Das Ritual nach dem Tod
Wenn ein solcher Kalligraf stirbt, tritt eine alte Überlieferung in Kraft, die selbst viele Muslime außerhalb der Kunstszene kaum kennen: Die über Jahre gesammelten Späne und Reste seiner Schreibgeräte werden zusammengetragen, um daraus ein heiliges Feuer zu entzünden.
Mit der Hitze dieses Feuers wird Wasser erhitzt – jenes Wasser, mit dem der Verstorbene gewaschen wird, bevor er nach islamischer Tradition bestattet wird.
Der Gedanke dahinter ist so ergreifend wie sinnig: Das Werkzeug, mit dem der Gelehrte sein Wissen, seine Kunst und seine Seele ausgedrückt hat, dient nun dazu, ihn auf seinem letzten Weg zu reinigen.
Damit kehrt sich der Lebenskreis symbolisch um: Aus dem Feuer, das einst der Schöpfung diente – dem Schreiben, dem Lehren, dem Gestalten –, wird nun das Feuer des Abschieds. Es ist eine still glimmende Hommage an das Lebenswerk des Schreibenden.
Überlieferung oder gelebte Praxis?
Beschreibungen dieses Rituals finden sich in mehreren Quellen aus der Welt der islamischen Kunst und Gelehrsamkeit. So berichtet etwa der türkisch-amerikanische Kunsthistoriker Hüsrev Subaşı von dieser Tradition unter Kalligrafen des Osmanischen Reiches. Auch moderne islamische Kunstportale erwähnen, dass Schüler und Familien diese Späne wie wertvolle Erbstücke aufbewahren, um sie für den Tag der letzten Reinigung des Meisters zu verwenden.
Wie weit diese Praxis heute tatsächlich verbreitet ist, lässt sich schwer sagen. Sicher ist aber: Der Gedanke lebt fort – als Symbol dafür, dass das geschriebene Wort, die Kunst des Schreibens und die geistige Hingabe eines Lebens im Tod nicht einfach enden, sondern weiterwirken.
Schreiben als spirituelle Handlung
Für die alten Kalligrafen war Schreiben mehr als Handwerk – es war eine Form der Meditation, ja des Gebets. Jeder Buchstabe, jede Linie hatte eine mystische Bedeutung. Die Feder war dabei das Instrument, das diese Verbindung zwischen Mensch und Göttlichem herstellte. Sie wurde deshalb mit Respekt behandelt – gereinigt, gepflegt und niemals achtlos beiseitegelegt.
Dass man nach dem Tod die Reste dieser Werkzeuge nutzt, um das Wasser für die Waschung des Körpers zu erhitzen, ist Ausdruck tiefster Ehrfurcht: Das Feuer dieser Späne ist das Feuer der Hingabe, das Feuer der Inspiration – es begleitet den Verstorbenen auf seiner letzten Reise.
Ein stilles Vermächtnis
In einer Welt, die Werkzeuge und Dinge meist nur nach ihrem Nutzen bewertet, erinnert uns diese alte türkische Tradition daran, dass jedes Werkzeug auch ein Zeuge ist – Zeuge des Tuns, des Schaffens, des Lernens. Der Kalligraf verbrachte sein Leben damit, Zeichen zu setzen. Und diese Zeichen hallen nach – nicht nur in seinen Werken, sondern auch in der Art, wie man ihm am Ende Respekt zollt.
Vielleicht ist das, was wir hier sehen, eine der schönsten Metaphern für den Beruf, für jede Art von Handwerk und für das Leben selbst: dass selbst die kleinsten Reste, die Späne und Splitter unseres Tuns, noch etwas bedeuten können – wenn man sie mit Liebe, Geduld und Achtung behandelt.
Und so wird aus dem letzten Feuer eines Gelehrten kein zerstörerisches, sondern ein reinigendes. Es verbrennt nichts – es verwandelt. Es lässt das, was vom Menschen bleibt, in Würde in den Kreislauf zurückkehren.
Episodenliste:
- Bestattung interkulturell: Einleitung
- Bestattung interkulturell: Christentum
- Bestattung interkulturell: Kirche Jesu Christi - Mormonen
- Bestattung interkulturell: Judentum 1
- Bestattung interkulturell: Judentum 2
- Bestattung interkulturell: Islam 1
- Bestattung interkulturell: Islam 2
- Bestattung interkulturell: Buddhismus 1
- Bestattung interkulturell: Buddhismus 2
- Bestattung interkulturell: Hinduismus 1
- Bestattung interkulturell: Hinduismus 2
- Bestattung interkulturell: Freimaurer
- Bestattung interkulturell: unterschiedliche Nationen
- Bestattung interkulturell: Luftbestattung Vogelbestattung, Himmelsbestattung
- Bestattung interkulturell: Altkatholische Kirche
- Bestattung interkulturell: Zeugen Jehovas
- Bestattung interkulturell: Griechisch orthodox
- Bestattung interkulturell: Sinti und Roma
- Bestattung interkulturell: Anthroposophen, Christengemeinschaft
- Bestattung interkulturell: Scientology
- Bestattung interkulturell: Aleviten
- Bestattung interkulturell: Bahai
- Bestattung interkulturell: Winter in Kanada
- Bestattung interkulturell: Baptisten
- Bestattung interkulturell: Kopten
- Bestattung interkulturell: Mennoniten
- Bestattung interkulturell: Japan
- Bestattung interkulturell: Schweiz
- Bestattung interkulturell: USA
- Bestattung interkulturell: Kremation in den USA vs. Deutschland
- Bestattung interkulturell: Mexiko - Día de los Muertos
- Bestattung interkulturell: Madagaskar - Famadihana - Knochenwendung
- Bestattung interkulturell: Alte europäische Naturreligionen
- Bestattung interkulturell: Satanismus
- Bestattung interkulturell: Voodoo Ahnenkult und Mythen
- Bestattung interkulturell: Philippinen - Baum- und Hängesärge
- Bestattung interkulturell: Südkorea - Feuer und Perlen
- Bestattung interkulturell: Ghana - Phantasiesärge
- Bestattung interkulturell: USA Einbalsamierung
- Bestattung interkulturell: Spanien - überirdische Gräber
- Bestattung interkulturell: Bulgarien
- Bestattung interkulturell: Korea
- Bestattung interkulturell: Postmortale Eheschließung
- Bestattung interkulturell: Warum Juden die Tora begraben
- Bestattung interkulturell: Kannibalismus
- Bestattung interkulturell: Amish People – Schlichtheit bis zuletzt
- Bestattung interkulturell - Türkei - Das heilige Feuer der Schreibspäne
- Bestattung interkulturell - Die Niederlande
- Bestattung interkulturell - Haitianisches Voodoo – Wenn der Geist weiterlebt
- Bestattung interkulturell: Voodoo und Zombies
- Bestattung interkulturell: Feuerbestattung im Wandel